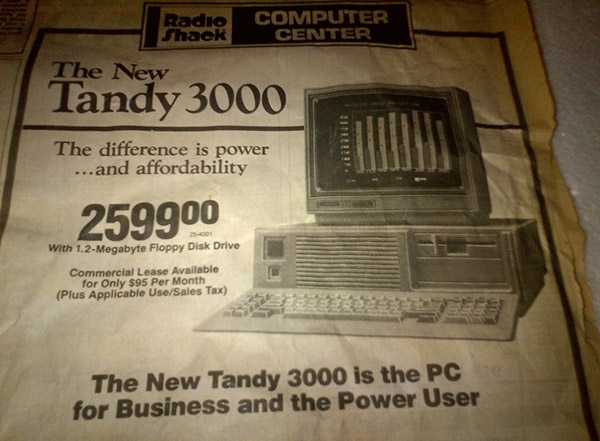Gehen Sie mit dem Thema Leichtbau zu weit?
„Leichtbau“ ist ein heiß diskutiertes Thema in der mechanischen Konstruktion. Einfach ausgedrückt: Mit verschiedenen CAD-/CAE-Tools wie Finite Elemente Design (FED) wird zuerst ein Design modelliert und simuliert. Anschließend wird Material selektiv entfernt oder seine Stärke verringert. Dann wird erneut die Simulation durchgeführt, um zu sehen, ob das Design immer noch umsetzbar ist. Ziel ist es, die Materialmenge zu minimieren und damit Größe und Gewicht zu reduzieren, während die Produktion (hoffentlich) vereinfacht und die Rohstoffkosten gesenkt werden.
Salopp gesagt: Es soll möglichst wenig Material verwendet werden und das Design soll trotzdem noch realisierbar sein. Prinzipiell ist das eine gute Idee, denn immerhin haben Gewichtsreduzierung und Kostensenkung bei fast allen Projekten oberste Priorität.
Früher, als es noch nicht diese leistungsstarken Simulations- und Modellierungs-Tools gab, haben die Entwickler eher weniger Material entfernt oder sogar zur Sicherheit lieber etwas mehr verwendet, nur „für den Fall“. Sie arbeiteten mit einer Kombination aus Analysen, Urteilsvermögen und Erfahrung, um zu entscheiden, an welchen Stellen dieses zusätzliche Extra erforderlich sein könnte. Heutzutage jedoch muss diese Marge so gut es geht minimiert werden, da die Tools anzeigen, dass alles in Ordnung ist.
Aber ist das auch wirklich so? Jeder Ingenieur weiß, dass jede Simulation nur so gut ist wie das Modell, an dem sie durchgeführt wird, und jedes Modell wiederum basiert auf einer Reihe von Annahmen und Vereinfachungen. Alles das wurde von Tony Abbey, einem FEA-Experten und -Ausbilder, in einem Artikel mit dem Titel „FEA Demos and Benchmarks“ in der Zeitschrift Digital Engineering deutlich gemacht.
Er gibt spezielle Beispiele, bei denen „kleine Dinge“ durch einige Standardanordnungen, die in vielen FEA-Konfigurationen weit verbreitet sind, vereinfacht werden, um ihre Konstruktion und Analyse zu erleichtern – was jedoch mit enormen Auswirkungen auf die Gültigkeit der Analysen verbunden ist.
Selbstverständlich sind nicht nur mechanische Konstruktionen in dieser Hinsicht anfällig. Bei elektronischen Designs gibt es dieselben Probleme. Nur sind diese weniger dramatisch als bei einer Halterung oder einem Träger, die versagen. Selbst wenn das Modell alle parasitären Effekte auf irgendeine Weise berücksichtigt, wie sollen selbige beziffert werden? Verändern sich diese Werte im Lauf der Zeit oder abhängig von der Temperatur? Wie verhält sich ihre Abweichung vom Nennwert aufgrund von normalen Materialien und fertigungsüblichen Abweichungen? Selbst bei einer korrekt konzipierten Monte-Carlo-Simulation für ein Design ist es praktisch unmöglich, selbige für alle möglichen Varianten durchzuführen.
 Abbildung 1: Die unvermeidliche Verlustleistung eines Widerstands führt zu einem Anstieg seiner Temperatur, was dazu führt, dass sein tatsächlicher Widerstand vom Nennwert abweicht. Das Diagramm zeigt den raschen Temperaturanstieg, wenn sich die Verlustleistung des Widerstands seiner Bemessungsleistung annähert. (Bildquelle: TT Electronics)
Abbildung 1: Die unvermeidliche Verlustleistung eines Widerstands führt zu einem Anstieg seiner Temperatur, was dazu führt, dass sein tatsächlicher Widerstand vom Nennwert abweicht. Das Diagramm zeigt den raschen Temperaturanstieg, wenn sich die Verlustleistung des Widerstands seiner Bemessungsleistung annähert. (Bildquelle: TT Electronics)
Die Modellgültigkeit ist nicht nur ein HF-Problem, sondern auch ein DC-Problem. Denken Sie nur an die allgegenwärtigen Strommesswiderstände, deren Werte sich üblicherweise im Bereich von Milliohm bewegen. Im Prinzip lässt sich ein solcher Widerstand durch ein kurzes Stück eines Kupferdrahts realisieren. Dies geht aufgrund der Selbsterhitzung des Drahtes und der daraus resultierenden Änderung seines Widerstands jedoch nicht sehr lange gut. Kupfer hat in der Regel einen Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TK) von etwa 4000 ppm/°C. Wenn also bei einem Widerstand mit einem Wert von 1 Milliohm (mΩ) die Temperatur um moderate 50 °C ansteigt, liegt der Widerstandswert schon bald bei 1,2 mΩ, was einer Änderung um 20 % entspricht (Abbildung 1).
Ein Design, bei dessen Validierung ausschließlich die elektronische Leistungsfähigkeit betrachtet wird, ohne thermische Effekte zu berücksichtigen, wird bestenfalls von geringer Qualität sein. Selbst Tools wie Comsol zur Simulation physikalischer Vorgänge, die eine Verknüpfung und Kopplung elektronischer, magnetischer, thermischer und mechanischer Analysen ermöglichen, benötigen nach wie vor Einblicke in diese Zusammenhänge.
Aus diesem Grund haben Anbieter von Spezialkomponenten wie Vishay Dale spezielle Widerstände mit einem niedrigen TK im Angebot, die auf komplexen Materialien und Prozessen basieren. Ihre Metallband-Leistungswiderstände der Serie WSBS8518 bieten beispielsweise einen TK zwischen ±110 und ±200 ppm/°C (abhängig vom Nennwiderstand), während die Produkte aus der Serie WSLP mit einem TK von lediglich ±75 ppm/°C sogar noch besser sind. Über andere Bezugsquellen sind außerdem hoch spezialisierte Widerstände mit TK-Werten im einstelligen Bereich erhältlich, die für meteorologische High-End-Anwendungen gedacht sind.
Etwas Bescheidenheit steht dem Entwickler im Allgemeinen gut zu Gesicht. Sofern Sie sich nicht absolut sicher sind, dass Ihr Modell gut genug ist, ergänzen Sie Ihr Design um eine geringe Zusatzmarge. Wenn die Verlustleistungsrechnung ergibt, dass Sie einen Widerstand mit 0,22 Watt benötigen, dann sollten Sie sich eher für eine Komponente mit ½ Watt entscheiden als für eine gerade noch ausreichende Komponente mit ¼ Watt. In den Tagen vor sowie in der Anfangszeit der Verwendung von Modellen waren sich die Entwickler darüber im Klaren, dass sie nicht allwissend waren. Daher gingen sie hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Sicherheit lieber auf Nummer sicher, statt sich nur auf das Allernötigste zu beschränken.
Die leistungsstarken Tools und Modelle von heute können sehr schnell dazu führen, dass Entwickler sich überschätzen und so tun, als ob sie alles wüssten. In der Realität kann es jedoch keineswegs schaden, wenn man sein Vertrauen in das Modell und die Situation bewertet und diese Bewertung in das Design und die Stückliste mit einfließen lässt.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum